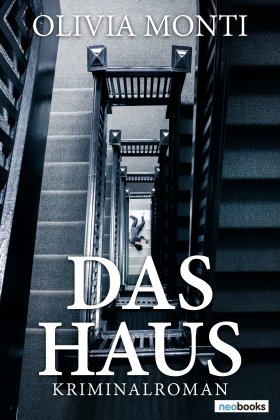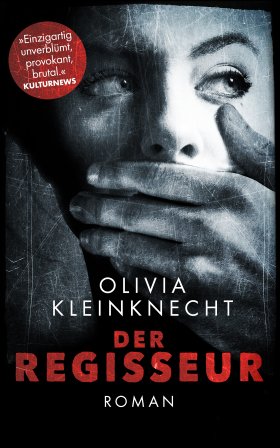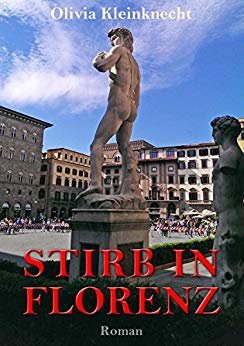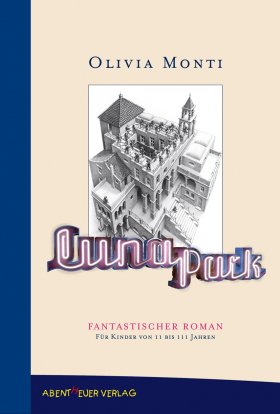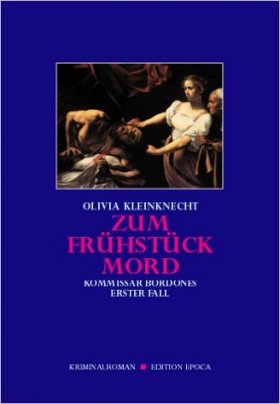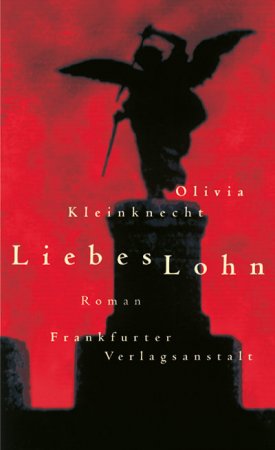Olivia Kleinknecht
Hallo, ihr Lieben,
zuerst das Langweilige:
Ich bin 1960 in Stuttgart geboren, bin Juristin und habe am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz über die „Positivität des Rechts bei Niklas Luhmann“ promoviert. Seit Urzeiten schreibe ich Romane und Sachbücher und habe u.a. bei der Frankfurter Verlagsanstalt und S. Fischer publiziert. Mitglied bin ich beim A.d.S, PEN, und der ESSWE.
Dann das Interessantere:
Seit längerem interessieren mich parapsychologische Inhalte:
Mein Sachbuch "Das Gedächtnis von Gegenständen" hat mich fünf Jahre Arbeit gekostet. Ich habe zuerst ein Jahr lang nur recherchiert und dann angefangen zu schreiben, dann weiter recherchiert, weil alle möglichen neuen Fragen auftraten, mich in Probleme verbissen, bis ich zu verstehen glaubte, worum es ging, Probleme gelöst und neue eingehandelt. Irgendwann sagst du: Schluss, das Ganze ist jetzt ziemlich plausibel und für jeden einigermaßen verständlich. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dieses verrückte Thema so zu erschließen, dass es einleuchtet, und habe es tausendfach belegt, da einem ja nicht jeder einfach glaubt, dass Dinge, Orte, einfach alles, ein Gedächtnis hat.
Wie kam ich auf ein so verrücktes Projekt? Der Ausgangspunkt war: Ich wollte unbedingt herausfinden, was ist eine Stimmung, was ist Atmosphäre? Man fühlt sich irgendwo bedrückt oder wohl, und es hat nicht nur mit den äußeren Umständen zu tun, sondern mit etwas vorderhand nicht Greifbarem, Verborgenem. Ein Ort, ein Ding strahlt etwas aus. Etwas liegt quasi in der Luft. Ist Stimmung, ist Atmosphäre sozusagen nur aus der Luft gegriffen? Oder ist sie viel wirklicher als wir meinen? Besteht sie gar aus irgendwelchen Teilchen (Materie- oder Kräfteteilchen)? So fing es an …
Momentan arbeite ich an einem kleinen Thriller/Krimi, in den ich ein paar meiner Rechercheergebnisse einfließen lassen kann.
Mein eben unter Olivia Monti erschienener Krimi "Der Pflegefall" behandelt ein ganz anderes Thema.Ich hänge für euch ein Lesepröbchen an.
Und damit der Eindruck quasi komplett wird, stell ich noch eine Booktuberin ein, die meinen Roman "Luna Park 2" (für Kinder von 11 bis 111) bespricht: Video. Es geht darin um die Finanzkrise in Europa auf Kinderniveau.
Auf gute Freundschaft, Olivia